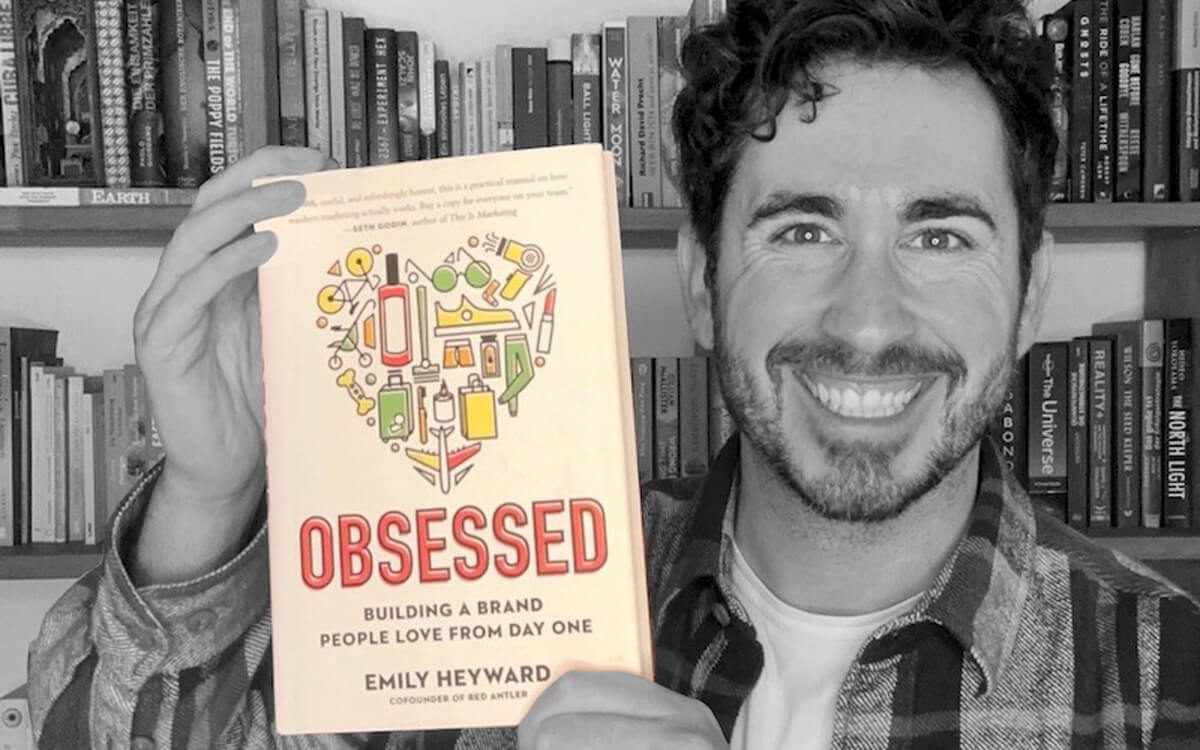Nachbericht "Can I trust myself?"

Unter dem Titel "Can I trust myself?" diskutierten Expert:innen aus Theologie, Psychologie, Recht und Werbung im Impact-Hub darüber, wie wir heute Vertrauen – zu uns selbst, zu anderen und zu Systemen – überhaupt noch fassen können. Ausgangspunkt war die Beobachtung, dass wir in einer Welt leben, in der sich Überzeugungen schnell ändern – und Zweifel gleichzeitig oft als Schwäche gilt.
Zwischen "Unterscheidung der Geister" und innerem Kompass
Wolfgang Kimmel führte mit der ignatianischen "Unterscheidung der Geister" in das Thema ein: Die Frage, welche inneren Stimmen uns in Ruhe, Freude und Weite führen – und welche in Unruhe, Selbstabwertung und Druck. Vertrauen in sich selbst, so seine These, entsteht nicht aus blindem "Sich-selbst-trauen", sondern im Dialog mit anderen und mit dem eigenen Inneren. Der Mensch werde am Du zum Ich – ohne Gegenüber kein tragfähiges Selbstvertrauen.
Psychologie des Vertrauens: Filter, Identität und Überforderung
Die klinische Psychologin Martina Rammer-Gmeiner beschrieb, wie stark unser Vertrauen heute von Technologie mitgeprägt wird: Wir verlassen uns blind auf Handy, Auto, Navi und permanente Information. Gleichzeitig zwingt uns die Informationsflut dazu, ständig zu filtern – wahr oder falsch, seriös oder Bullshit. Besonders Jugendliche seien davon belastet.
Sie zeigte auf, wie politische und ideologische Kategorien ins Rutschen geraten: Linke und rechte Extreme teilen plötzlich gleiche Narrative, vertraute Ordnungssysteme brechen weg. Das erzeuge Kontrollverlust, sei aber auch eine Chance zur Neubestimmung von Werten und Identität. Vertrauen entstehe weniger darüber, ob etwas "objektiv wahr" ist, sondern ob jemand authentisch wirkt.
Recht und Zweifel: "Im Zweifel für den Angeklagten"
Rechtsanwältin Kathrin Schuhmeister brachte die rechtliche Perspektive ein: Im Rechtsstaat ist Zweifel keine Schwäche, sondern Prinzip – "im Zweifel für den Angeklagten". Entscheidend seien Fakten und Beweisbarkeit; wo Zweifel nicht auflösbar ist, sind juristische Grenzen erreicht.
Sie sprach über Fehlerkultur in ihrer Arbeit: Mandant:innen kommen oft mit "Mist", den es rechtlich zu sortieren gilt. Ein klares eigenes Wertebild helfe ihr, sich nicht erschüttern zu lassen und auch zu erkennen, wann eine Zusammenarbeit keinen Sinn macht. Selbstvertrauen heißt für sie: die eigenen Werte kennen, Trigger verstehen und Entscheidungen daran ausrichten.
Werbung, Medien und der Zweifel als Werkzeug
Werber Christian Hellinger beleuchtete die Rolle von Narrativen und Algorithmen. In Social Media sei es schwer, "unbiased" zu bleiben – Algorithmen verstärken bestehende Meinungen, statt Zweifel zu fördern. Der Verlust von "Third Places" (Wirtshaus, Parkplatz, Stammtisch) nehme uns Räume, in denen man mit anderen Meinungen zwangsläufig konfrontiert war.
In der Kommunikation sei Zweifel ambivalent: Gute Werbung könne durch Zweifel Verhalten verändern ("Zahle ich zu viel? Ist das wirklich gut genug?"), aber wenn an der Wahrheit des Narrativs gezweifelt wird, ist der Job schlecht gemacht.
KI, Dunning-Kruger und die Kunst des Hinterfragens
Mehrere Beiträge aus dem Publikum brachten Künstliche Intelligenz und Algorithmen ins Spiel: Sie verstärken oft die Anfangsmeinung, statt Entwicklung zu ermöglichen. Der Dunning-Kruger-Effekt wurde als Beispiel genannt: Wer wenig weiß, überschätzt sich – echte Auseinandersetzung führt erst einmal zu mehr Unsicherheit, bevor tiefere Kompetenz wieder Sicherheit schafft. Technologie stärke oft genau den ersten Hügel, statt über ihn hinauszuführen.
Selbstvertrauen ohne absolute Wahrheit?
Im Laufe der Diskussion verschob sich der Fokus immer stärker auf die Frage: Brauche ich "die Wahrheit", um mir selbst zu vertrauen? Einige Stimmen betonten: Für Selbstvertrauen brauche es vor allem Werte und ein inneres Fundament, nicht notwendigerweise eine universale, von allen geteilte Wahrheit.
Wiederkehrende Motive waren:
- Zweifel als Form der Reflexion, nicht als Schwäche
- Das Spannungsfeld zwischen beruflichen und privaten Entscheidungen
- Der Mut, Aufträge oder Beziehungen abzulehnen, wenn etwas nicht stimmig ist
- Die Erfahrung, dass geteilte Zweifel verbinden und Beziehung vertiefen können
Am Ende blieb kein einfaches Rezept, aber eine gemeinsame Linie:
Zweifel gehört wesentlich zu Selbstvertrauen dazu. Nicht, weil wir nichts wissen, sondern weil wir bereit sind, unser Wissen, unsere Überzeugungen und unsere Beziehungen immer wieder zu prüfen – im Licht unserer Werte und im Dialog mit anderen.
Trotz der frühen Stunde entwickelte sich dank unserer vier Gäste und der Moderation ein lebendiger Gedankenaustausch – mit Themen, die selbst für Strategie Austria ungewöhnlich tief gingen. Zwischen hoher Philosophie und sehr persönlichen Einblicken stand die Frage im Raum: Kann ich mir trauen – und wem oder was eigentlich noch?
Die Beiträge und das Feedback der rund 25 Teilnehmer:innen zeigten klar, dass sich "sperrige" Themen jenseits des beruflichen Alltags lohnen. Wir freuen uns schon auf das nächste Mal.
Autor:in
Strategie Austria-Mitglied seit 2019